
Ich sah ein hungriges kleines Mädchen, das allein im Park saß - und erkannte, dass sich unsere Wege aus einem bestimmten Grund gekreuzt hatten
Ich war gerade mit Lebensmitteln auf dem Heimweg, als ich ein kleines Mädchen sah, das allein im Dunkeln saß. Sie bat mich um Essen, aber was sie wirklich brauchte, war etwas viel Wichtigeres. Keiner von uns wusste, dass wir dabei waren, uns gegenseitig zu retten.
Werbung
Mein Name ist Kate, und ich bin 39 Jahre alt. Ich bin alt genug, um die Art von Schmerz erlebt zu haben, die im Hintergrund deines Lebens bleibt, aber immer noch jung genug, um zu spüren, wie er sich wieder anschleicht, wenn du es am wenigsten erwartest.
Ich lebe allein in einer kleinen Wohnung im nördlichen Teil der Stadt, in einem Viertel, in dem die meisten Leute unter sich bleiben. Hier kann man jahrelang um denselben Block gehen und kennt trotzdem nicht den Namen seines Nachbarn. Ich arbeite in einer örtlichen Buchhandlung. Es ist ein ruhiger Job, und er passt zu meinem ruhigen Leben. Im Moment ist das genau das Richtige für mich.

Eine Frau wischt ein Regal in einer Buchhandlung ab | Quelle: Pexels
Ich war nicht immer so. Es gab eine Zeit, in der sich jeder Teil von mir nach mehr sehnte, nach etwas, das größer ist als ich selbst.
Werbung
Alles, was ich jemals wollte, war eine Mutter zu sein. Das war der Traum, einfach und beständig, wie der Duft von warmer Wäsche oder der Klang eines Schlafliedes. Mein Mann Mark und ich verbrachten Jahre damit, ihn zu verfolgen. Wir haben alles versucht: Fruchtbarkeitsbehandlungen, Medikamente, einen Arzt nach dem anderen. Wir haben mehr als einmal eine künstliche Befruchtung durchgeführt. Ich bin sogar nach Arizona geflogen, um eine ganzheitliche Klinik auszuprobieren, auf die eine Freundin schwor.
Ich trank bitteren Tee und stach mich mit Nadeln. Ich nahm Nahrungsergänzungsmittel, stellte meine Ernährung um und überarbeitete meinen gesamten Lebensstil. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass es hilft, bei Vollmond auf einem Fuß zu stehen, hätte ich das auch getan.

Nahaufnahme einer Frau, die ein Medikament einnimmt | Quelle: Pexels
Werbung
Jeder Monat verlief nach demselben schrecklichen Muster: Erst kam die Hoffnung, dann das lange Warten und schließlich der Herzschmerz.
In den Nächten, in denen der Kummer mich zu erdrücken drohte, hielt mich Mark immer im Bett fest. Ich weinte in ein Kissen, damit die Nachbarn es nicht hören konnten, und flüsterte Gebete in die Dunkelheit wie ein Kind.
Aber irgendwann begannen wir uns zu entfremden. Der Funke erlosch und die Stille füllte die Räume, in denen früher das Lachen war. Er sagte, ich sei besessen und er könne es nicht ertragen, mich in einer Spirale zu sehen. Eines Nachts sagte er es einfach, klar und kalt.
„Ich kann das nicht mehr, Kate.“
Und dann war er weg.
Weg war der Mann, den ich liebte. Vorbei war die Zukunft, die ich mir so klar ausgemalt hatte; ich konnte sie schmecken.

Ein Mann, der weggeht | Quelle: Pexels
Werbung
Ich dachte, ich hätte schon alle Tränen geweint, die ich hatte. Aber irgendwie tat die Stille, nachdem er gegangen war, noch mehr weh als all die Nächte des Schluchzens.
Das war vor einem Jahr. Seitdem setze ich einen Fuß vor den anderen. Ich habe einfach die Tage überstanden.
An diesem Abend habe ich nicht wirklich an all das gedacht. Zumindest nicht bewusst.
Es war eine dieser klaren Herbstnächte, in denen sich alles ein bisschen weicher anfühlt. Die Luft war leichter, das Licht sanfter und selbst das Geräusch der eigenen Schritte schien leiser zu sein. Der Wind trug den Duft von nassen Blättern und Holzrauch heran. Es war die Art von Nacht, die dich an Lagerfeuer aus deiner Kindheit und vergessene Lieder denken lässt.
Ich war nach der Arbeit gerade aus dem Bus gestiegen und lief die letzten paar Blocks nach Hause. Meine Einkaufstasche war leicht und schaukelte sanft an meiner Hüfte. Darin befanden sich ein paar grundlegende Dinge: Brot, Suppe, eine Dose Bohnen und ein Donut, den ich nicht brauchte, dem ich aber nicht widerstehen konnte.
Ich wollte mir gerade die Suppe aufwärmen und vielleicht etwas schlechtes Reality-TV gucken, als ich sie sah.
Werbung
Ein kleines Mädchen, das allein auf der Bank neben dem Laden an der Ecke saß.

Ein kleines Mädchen sitzt nachts draußen auf einer Bank | Quelle: Midjourney
Sie konnte nicht älter als sieben sein. Vielleicht acht, aber selbst das kam mir übertrieben vor.
Sie war winzig. Ihr dunkelbraunes Haar war zerzaust und ein bisschen zu lang, als ob es seit Tagen nicht mehr richtig gebürstet worden wäre. Ihr Rucksack hing von einer Schulter herab, als wäre er zu schwer für sie. Ihre Beine reichten nicht bis zum Boden. Sie schwangen nur hin und her, langsam und unsicher, als wüsste sie nicht, ob sie rennen oder stehen bleiben sollte.
Ich wurde langsamer, ohne es zu wollen. Irgendetwas an ihr hat mich einfach ... angezogen.
Werbung
Ich trat ein wenig näher und kniete mich auf ihre Augenhöhe.
„Hey, Süße“, sagte ich sanft. „Geht es dir gut? Wo ist deine Mutter?“
Sie schaute auf und mir wurde ganz anders ums Herz. Ihre Augen waren groß und braun, zu ernst für ihr kleines Gesicht. Sie schluckte schwer, bevor sie sprach.
„Mama ist heute Morgen gegangen“, sagte sie. „Sie ist nicht zurückgekommen.“
Ihre Stimme schwankte ein wenig, aber sie weinte nicht. Sie sah nur erschöpft aus, eine Müdigkeit, die nichts mit Schlaf zu tun hatte.
Ich hielt inne und überlegte, was ich als nächstes sagen sollte. Aber dann sprach sie wieder, kaum mehr als ein Flüstern.
„Hast du etwas zu essen?“
Ich blinzelte.
„Etwas zu ... oh.“
Ich hielt meine Einkaufstasche hoch.
„Ich glaube schon.“
Ich öffnete die Tüte und holte den Donut heraus. Er war noch warm durch die Papiertüte hindurch.
Werbung

Eine Person hält einen Donut | Quelle: Pexels
„Hier, Schatz“, sagte ich. „Es ist nicht viel, aber er ist süß.“
Sie nahm ihn in beide Hände, als wäre er etwas Kostbares. Dann verschlang sie es so schnell, dass mir die Brust wehtat.
„Hast du ein Telefon?“, fragte ich. „Oder weißt du vielleicht deine Adresse? Wir können versuchen, jemanden anzurufen?“
Sie schüttelte schnell den Kopf, ihr Haar strich ihr über die Wangen.
„Nein, Mama hat gesagt, sie kommt bald zurück.“
Ich nickte langsam.
„Okay. Kann ich mit dir warten, bis sie zurückkommt?“
Werbung
Sie zögerte. Dann nickte sie.
„Du kannst warten“, sagte sie leise, „aber bitte ruf nicht die Polizei.“

Nahaufnahme eines Polizeiautos | Quelle: Pexels
Ich runzelte die Stirn.
„Warum nicht, mein Schatz?“
Ihre Augen füllten sich mit etwas, das an Panik grenzt.
„Weil sie mir Mami wegnehmen werden. Und mich auch.“
Sie umklammerte ihren Rucksack fester, als ob er das Einzige wäre, was sie zusammenhielt.
Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte.
Werbung
Also setzte ich mich einfach neben sie.
Wir unterhielten uns ein bisschen, immer mal wieder.
Auf ihrem Rucksack waren Cartoon-Katzenaufnäher, von denen einige an den Ecken abblätterten. Ihre Lieblingsfarbe war lila. Sie liebte es zu zeichnen, besonders Blumen und Drachen.

Ein Kind zeichnet eine Blume mit Buntstiften | Quelle: Unsplash
„Ich mag es, die Drachen rosa zu malen“, sagte sie mir. „Weil die Leute immer denken, dass sie für Jungs gedacht sind.“
Darüber musste ich lächeln.
„Rosa Drachen hören sich für mich ziemlich stark an.“
Sie nickte ernst.
Werbung
„Sie spucken Glitzerfeuer.“
Mit fortschreitender Nacht leerte sich die Straße. Der Laden an der Ecke schaltete seine Leuchtreklame aus. Das Brummen der Stadt wurde leiser und stiller.
Um 21:30 Uhr waren meine Finger schon ganz taub. Der Wind hatte aufgefrischt und wir waren die Einzigen, die noch draußen waren.
Ich schaute zu ihr hinunter. Sie hatte nur noch einen dünnen Kapuzenpulli an und drückte sich an ihre Knie.
„Süße“, sagte ich leise und zückte mein Handy. „Ich will nur sichergehen, dass du in Sicherheit bist, okay? Ich werde ...“

Eine Person hält ein Telefon | Quelle: Pexels
Doch bevor ich zu Ende sprechen konnte, keuchte sie auf.
Werbung
Sie sprang von der Bank auf und ihr Donutpapier fiel auf den Boden.
Ihre Augen wurden groß, nicht vor Erleichterung, sondern vor Angst.
Ich drehte mich um, um zu sehen, was sie dazu gebracht hatte, so zu reagieren.
Und da sah ich, wen sie anstarrte.
Ein Mann stand am Ende des Bürgersteigs, direkt hinter dem Lichtkegel der nächsten Straßenlaterne. Er schien Mitte vierzig zu sein und sah aus, als hätte er einen Tag hinter sich gebracht, den niemand unverändert übersteht.
Seine Stiefel waren mit getrocknetem Schlamm überzogen und seine Arbeitsjacke war mit Staub und Sägespänen übersät. In der Hand hielt er eine einzelne Blume, schlaff und am Stiel geknickt, als hätte er sie in der Eile gepflückt und irgendwo unterwegs vergessen.

Nahaufnahme einer rosa Rose auf einer weißen Fläche | Quelle: Pexels
Werbung
Als er das kleine Mädchen neben mir sitzen sah, schien sein ganzer Körper zusammenzubrechen. Seine Schultern gaben nach und etwas in seinem Gesicht bröckelte einfach.
„Lily“, sagte er, kaum mehr als ein Flüstern. „Schätzchen ... Ich habe dich gesucht.“
Das Mädchen erstarrte. Ich spürte, wie sich ihr Körper neben mir versteifte. Zuerst bewegte sie sich nicht, dann drehte sie ihren Kopf zu mir und flüsterte: „Das ist Mamas Freund.“
Ich warf einen Blick auf den Mann zurück. Sein Gesicht war blass, als hätte er den ganzen Tag nichts gegessen, und seine Augen waren geschwollen und rot, nicht nur von den Tränen, sondern weil er zu viele davon zurückgehalten hatte.
Er machte einen Schritt vorwärts, dann noch einen, vorsichtig, als könnte sie weglaufen.
„Es tut mir so leid, dass ich nicht früher hier war“, sagte er sanft. „Ich ... Ich wusste nicht, wie ich es dir sagen sollte.“
Er kniete langsam nieder, die Blume zitterte in seinen Fingern. Er sah aus, als würde er gleich auf dem Bürgersteig zusammenbrechen.
„Deine Mutter ist heute Nachmittag verstorben. Sie war schon lange Zeit sehr krank. Sie hat versucht, für dich durchzuhalten, aber jetzt ist sie nicht mehr da.“
Werbung

Eine Patientin, die auf einem Krankenhausbett liegt | Quelle: Pexels
Lily hat nicht geschrien. Sie hat auch keine Fragen gestellt. Ihr kleines Gesicht verzog sich einfach in sich selbst. Ein Geräusch kam aus ihr heraus, leise und klein, rau wie Luft, die aus einem Ballon entweicht, der bereits geplatzt ist.
Ich konnte nicht atmen.
In diesem Moment spürte ich, wie sich etwas in mir veränderte. Etwas Altes und Verschüttetes begann sich zu regen. Es war derselbe stille Schmerz, den ich immer verspürte, wenn ich auf leere Räume starrte, auf Testergebnisse, die ich nicht lesen konnte, und auf eine Zukunft, die nie kam. Nur war es dieses Mal nicht nur meiner.
Ich hatte meinen eigenen Verlust erlebt, tausend Nächte voller stiller Tränen und einen Traum, den ich loslassen musste, als das Leben sich weigerte, sich meinem Willen zu beugen.
Werbung
Ich zeichnete winzige Namen in das Kondenswasser an meinem Schlafzimmerfenster, Namen, die ich nie vergeben konnte. Ich stellte mir das Gewicht eines Kinderkopfes an meiner Schulter vor, wie ein Puzzleteil, das ich nie hatte, perfekt passen würde.

Eine verzweifelte Frau, die sich an ein Holzfenster lehnt | Quelle: Pexels
Aber zu sehen, wie ein Kind mit einem einzigen Satz alles verliert, hat etwas in mir aufgerissen, von dem ich nicht wusste, dass es noch da war.
Sie hat nichts gesagt. Sie griff einfach blindlings nach meiner Hand und drückte sie so fest, dass es fast wehtat.
Der Mann wischte sich mit dem Handrücken das Gesicht ab und stand langsam auf.
„Lily, Schatz. Wir müssen den Sozialdienst anrufen. Sie werden sich um dich kümmern. Sie werden einen sicheren Ort für dich finden.“
Werbung
Daraufhin drehte sich Lily zu mir um und klammerte sich an meinen Ärmel.
„Muss ich gehen?“, flüsterte sie mit vor Angst geweiteten Augen.
Der Mann sah hilflos aus, die Hände an den Seiten geöffnet.
„Sie hat keine Familie“, sagte er. „Ihre Mutter hat kein Testament hinterlassen. Rechtlich gesehen, gibt es keine andere Möglichkeit.“
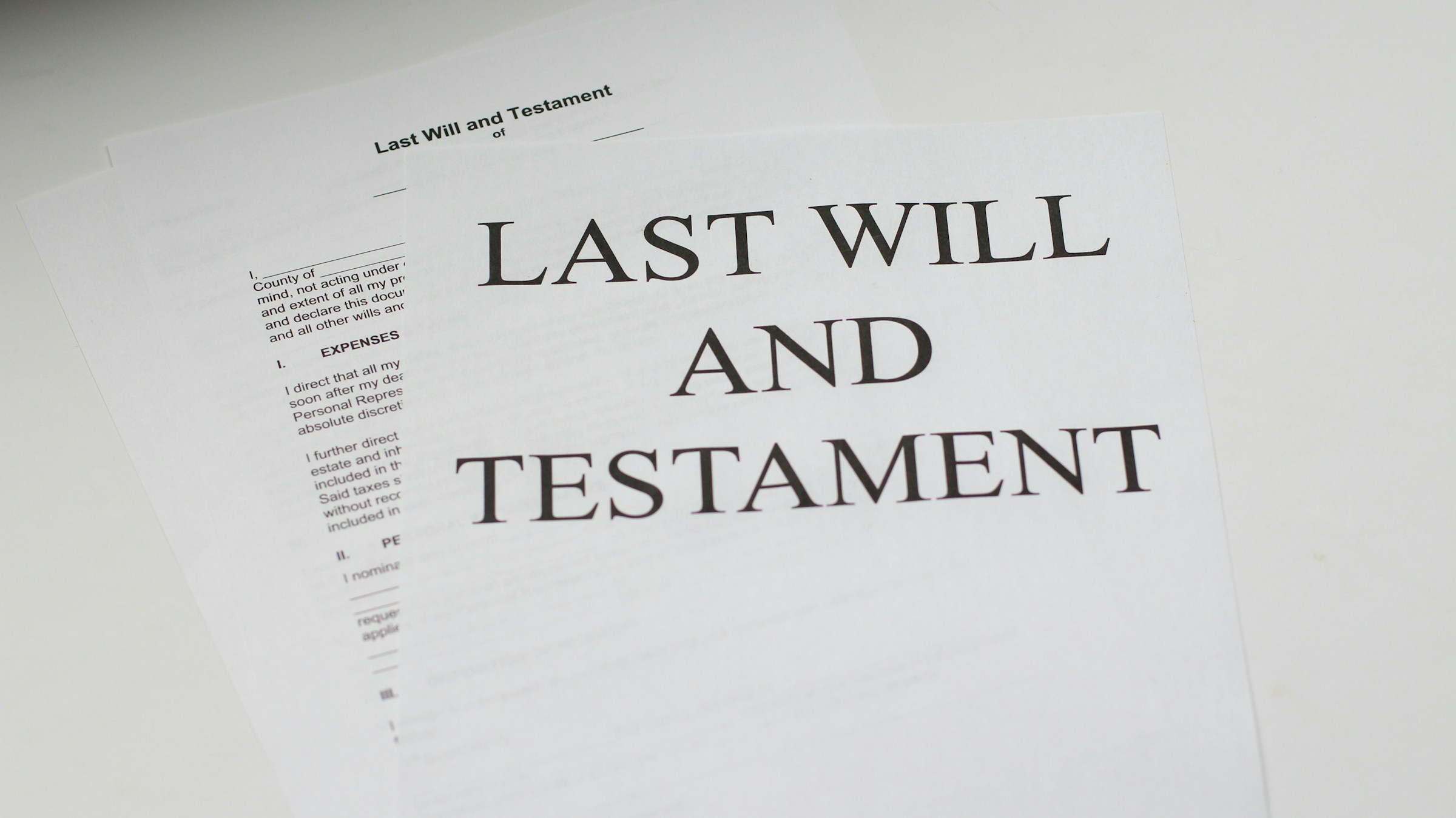
Ein testamentarisches Dokument | Quelle: Unsplash
Ich schaute Lily an, dann den Mann.
„Hast du sie gut gekannt?“, fragte ich.
Er nickte langsam.
„Mein Name ist Travis. Ich arbeite in der Autowerkstatt am Ende der Straße. Lilys Mutter, Carla, brachte ihr Auto jeden Monat oder so hierher. Wir kamen ins Gespräch. Irgendwann fingen wir an, uns zu treffen. Zuerst war es nichts Ernstes. Sie mochte es nicht, Leute zu nahe an sich heranzulassen. Aber wir haben es geschafft ... sozusagen.“
Werbung
Er seufzte und fuhr sich mit einer Hand über das Gesicht. „Als sie krank wurde, wollte sie nicht, dass es jemand erfährt. Sie hatte Angst, dass man ihr Lily wegnehmen würde, bevor es so weit war. Ich habe erst vor ein paar Stunden erfahren, dass sie tot ist. Ihr Nachbar hat mich angerufen.“
Er sah auf die Blume in seiner Hand hinunter, als hätte er vergessen, dass sie überhaupt da war.
„Sie sagte mir, ich solle Lily suchen, wenn ihr etwas zustößt. Um sicherzugehen, dass sie nicht alleine ist.“

Ein Mann wischt sich die Tränen ab | Quelle: Pexels
Ich schluckte schwer und spürte, wie sich Lilys kleine Finger um meine legten.
Travis nahm einen zittrigen Atemzug.
Werbung
„Aber ich bin nicht ihr gesetzlicher Vormund. Ich kann sie nicht behalten.“
Ich schaute Lily wieder an. Ihre Augen waren voller Tränen, aber sie hatte seit dem ersten gebrochenen Ton keine einzige mehr fallen lassen. Sie hielt sich einfach fest.
Also riefen wir an.
Der Sachbearbeiter sagte, dass in dreißig Minuten jemand da sein würde. Während wir warteten, schritt Travis leise umher und fuhr sich immer wieder mit der Hand durch die Haare, als ob er versuchen würde, sich aufrecht zu halten. Ich blieb neben Lily sitzen und hielt immer noch ihre Hand.
Der Himmel hatte sich inzwischen völlig verdunkelt und die Straße war leer. Das einzige Geräusch war das gelegentlich vorbeifahrende Auto in der Ferne.

Ein Auto auf der Straße bei Nacht | Quelle: Pexels
Werbung
Ich drehte mich vorsichtig zu ihr um.
„Süße, ich weiß, dass das viel ist. Und ich weiß, dass du Angst hast. Aber ich muss dich etwas fragen, okay? Nur ganz ehrlich.“
Sie wischte sich mit dem Ärmel ihres Hoodies über das Gesicht und nickte.
„Wenn das Gericht es erlaubt, würdest du dann bei mir bleiben wollen? Nur für jetzt. Bis alles geklärt ist. Vielleicht auch länger, wenn du möchtest.“
Sie antwortete nicht sofort. Stattdessen beugte sie sich vor und legte ihre Stirn leicht gegen meine.
„Du bist nett“, flüsterte sie. „Du bist bei mir geblieben. Du bist nicht weggegangen. Ich will bei dir bleiben.“
Ich schloss für einen Moment die Augen. Dieser Satz machte mich fertig.
Als die Sachbearbeiterin endlich kam, eine Frau in einem weißen Kittel mit müden Augen und einem Klemmbrett, ließ Lily meine Hand nicht los. Ihre Finger schlüpften wieder in meine, zitternd, aber fest, als ob sie sich beim Loslassen völlig auflösen würde. Ich konnte spüren, wie sich ihr Atem an meiner Seite beschleunigte. Sie versteckte sich hinter mir, als wäre ich das Einzige, was in ihrer Welt noch fest ist.
Werbung
„Sie gehört zu mir“, sagte ich mit festerer Stimme, als ich erwartet hatte.
Die Frau schaute mich an, dann Travis und dann Lily.

Eine Frau in einem weißen Kittel hält einen Ordner mit Dokumenten | Quelle: Pexels
„Du bist ihr Vormund?“, fragte sie.
„Noch nicht“, sagte ich. „Aber ich würde es gerne werden.“
Das war der Anfang.
Was folgte, war nicht einfach. Es gab Vorstellungsgespräche, Formulare, Hausbesuche und Hintergrundüberprüfungen. Sie inspizierten meine Wohnung, fragten mich nach meinem Job, überprüften mein Einkommen, meine psychische Verfassung und mein Unterstützungsnetzwerk. Sie untersuchten alles.
Werbung
Es gab Momente, in denen ich dachte, ich würde es nicht schaffen. Dass sie nein sagen würden. Dass ich zu alt, zu alleinstehend oder emotional zu zerbrechlich wäre. Aber jedes Mal, wenn Lily nach der Schule zu mir lief oder mich fragte, ob ich ihr die Haare flechten könnte, oder kleine lila Drachenzeichnungen an meinem Kühlschrank hinterließ, wusste ich, dass ich für sie kämpfen musste.

Eine Frau flechtet einem kleinen Mädchen die Haare | Quelle: Pexels
Sie hatte alles verloren. Ich habe gar nicht gemerkt, wie leer meine Welt war, bis sie anfing, sie zu füllen, einen ruhigen Moment nach dem anderen.
Eines Nachmittags, nach einem Hausbesuch, saß sie mit mir auf der Couch und schlug die Beine über die Seite.
„Meinst du, meine Mutter wäre sauer?“, fragte sie plötzlich.
Werbung
„Wütend? Warum?“ Ich drehte mich um und sah sie an.
„Dass es mir hier gefällt“, sagte sie leise. „Dass ich nicht die ganze Zeit traurig bin.“
Ich legte einen Arm um sie.
„Nein, mein Schatz. Ich glaube, sie wäre sehr, sehr froh, dass du irgendwo in Sicherheit bist. Irgendwo, wo es dir gut geht.“
Sie nickte langsam und lehnte sich an mich.

Eine Tochter, die ihre Mutter von hinten umarmt | Quelle: Pexels
„Ich vermisse sie immer noch.“
„Ich weiß.“
„Manchmal rede ich in meinem Kopf mit ihr. Ist das komisch?“
Werbung
„Überhaupt nicht“, sagte ich. „Ich spreche auch manchmal in meinem Kopf mit anderen.“
„Redest du auch mit deinem Baby?“
Das hatte ich nicht erwartet. Ich spürte, wie mir ein Kloß im Hals hochkam.
„Das habe ich“, sagte ich nach einer langen Pause. „Für eine lange Zeit.“
„Was hast du gesagt?“
Ich sah zu ihr hinunter und strich ihr Haar zurück.
„Dass ich sie liebe. Dass ich gewartet habe.“
Sie war lange Zeit still.
„Ich glaube, sie haben mich zu dir geschickt.“
Meine Augen brannten.
Ein paar Wochen später hatten wir unsere letzte Anhörung. Der Richter war freundlich, ein älterer Mann mit sanften Augen, der Lily ansah, als ob sie aus Glas und Gold wäre.

Die Hand eines Richters, die einen Hammer hält | Quelle: Pexels
Werbung
Als er schließlich sagte: „Volle Vormundschaft gewährt“, drückte Lily meine Hand so fest, dass es wehtat.
„Heißt das, dass du jetzt wirklich meine Mutter bist?“, fragte sie knapp über ein Flüstern hinaus.
Ich zog sie in meine Arme.
„Wenn du es willst.“
Sie nickte an meiner Schulter.
„Ich will.“
An diesem Tag blühte etwas in mir auf, von dem ich dachte, ich hätte es schon lange begraben. Es war nicht nur Liebe. Es war ein Gefühl der Bestimmung und Zugehörigkeit.
An diesem Nachmittag gingen wir nach Hause und aßen Pfannkuchen zum Abendessen, einfach weil wir konnten. Lily zog meinen Kapuzenpulli an und tanzte in der Küche herum, während ich sie wendete. Sie brachte mich so sehr zum Lachen, dass ich weinen musste.

Eine Frau und ein kleines Mädchen schauen sich an, während sie im Bett liegen | Quelle: Unsplash
Werbung
Und später am Abend, als sie neben mir auf der Couch einschlief und eine Hand in meine legte, wurde mir etwas klar.
Ich war nicht nur geheilt.
Ich war zu Hause.
Und dieses Mal verlor ich nicht noch eine Familie.
Ich baute eine auf.
Werbung
Werbung
